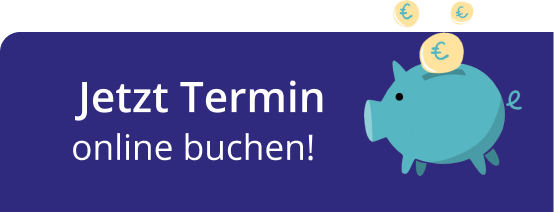9. Februar 2024 - Kommentare deaktiviert für Firmenwagen: Gesellschafter einer Personengesellschaft
Wie die private Nutzung eines Firmenwagens bei den Gesellschaftern einer Personengesellschaft zu ermitteln ist, hängt vom Umfang der betrieblichen Fahrten ab, die mit dem Fahrzeug unternommen werden. Wird das Fahrzeug ausschließlich (also zu 100%) betrieblich genutzt, können alle Aufwendungen uneingeschränkt als Betriebsausgaben abgezogen werden. Ohne Fahrtenbuch muss es sich um ein Fahrzeug handeln, das üblicherweise nur betrieblich genutzt werden kann. Dazu gehören
- Fahrzeuge, die kraftfahrzeugsteuerrechtlich als Zugmaschinen zugelassen sind
- LKW, weil sie üblicherweise nicht für Privatfahrten verwendet werden. Eine Ausnahme besteht jedoch bei Geländewagen, Vans usw., die üblicherweise für private Fahrten genutzt werden,
- andere Fahrzeuge, die in erster Linie für den Transport von Gegenständen eingerichtet sind, z. B. Werkstattwagen,
- Fahrzeuge, die der Unternehmer an Arbeitnehmer oder freie Mitarbeiter als Firmenwagen überlassen hat.
Bei einem Fahrzeug, das nach seiner objektiven Beschaffenheit so gut wie ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimmt ist, braucht keine private Nutzung versteuert zu werden. Maßgebend ist nicht die kraftfahrzeugsteuerliche oder verkehrsrechtliche Einstufung, sondern die Beschaffenheit des Fahrzeugs. Bei einem Werkstattwagen, der aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimmt ist, darf das Finanzamt keine private Nutzung unterstellen. Liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das Fahrzeug tatsächlich privat genutzt wurde, ist auch keine Privatnutzung anzusetzen.
Ermittlung des betrieblichen Nutzungsumfangs: Bei einem PKW reicht die bloße Behauptung, dass ein Fahrzeug nicht für Privatfahrten genutzt wird oder die Privatfahrten ausschließlich mit einem anderen (privaten) Fahrzeug durchgeführt werden, nicht aus. Denn üblicherweise wird ein PKW selbst dann für Privatfahrten verwendet, wenn ein anderes Fahrzeug zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass der Firmen-PKW nicht privat genutzt wird, kann in der Regel nur mit einem Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Hat die Personengesellschaft mehrere Firmen-PKW, kann sie die Privatfahrten nur dann problemlos abgrenzen, wenn für jedes Fahrzeug ein Fahrtenbuch geführt wird. Bei mehreren Firmen-PKW, die überwiegend betrieblich genutzt werden, hat der Gesellschafter die Wahl. Er kann für das von ihm genutzte Fahrzeug
- ein Fahrtenbuch führen oder
- die pauschale 1%-Methode anwenden.
Die Gesellschafter sind allerdings nicht verpflichtet, das Wahlrecht einheitlich auszuüben. Jeder Gesellschafter entscheidet für sich, wie er verfahren will.
Ohne Fahrtenbuch müssen die Gesellschafter für jedes überwiegend betrieblich genutzte Fahrzeug, das sie oder eine andere Person, die zu ihrem Haushalt gehört, auch privat nutzen, die pauschale 1%-Methode anwenden. Das Finanzamt unterstellt, dass jede Person mit Führerschein, die zum Haushalt eines der Gesellschafter gehört, ein Fahrzeug für Privatfahrten verwendet. Es darf also nicht nur auf die Gesellschafter abgestellt werden. Vielmehr müssen auch die Nutzungsmöglichkeiten der Ehegatten und anderer nahestehender Personen eines jeden Gesellschafters einbezogen werden. Dieser Beweis des ersten Anscheins wird jedoch entkräftet, wenn sich parallel ein gleichwertiges Fahrzeug im Privatvermögen befindet.
Sind mehr Fahrzeuge vorhanden als mögliche Privatnutzer, ist die 1%-Methode nur für die Fahrzeuge mit dem jeweils höchsten Listenpreis anzusetzen. Befinden sich im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft z. B. drei PKW und besteht eine Personengesellschaft aus zwei alleinstehenden Gesellschaftern und können sie glaubhaft darlegen, dass keine Person aus ihrer Privatsphäre eines dieser Fahrzeuge für private Zwecke nutzt, dann sind 1% pro Monat vom Bruttolistenpreis nur für die beiden teuersten Fahrzeuge anzusetzen.
Quelle:EStG| Gesetzliche Regelung| § 6 Abs. 1 Nr. 4| 08-02-2024