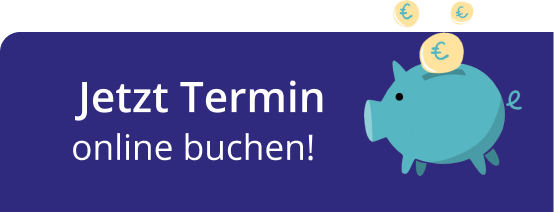3. November 2023 - Kommentare deaktiviert für Unterstützung für Ukraine Geschädigte
Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen: Bis zum 31.12.2024 genügt als Nachweis der Zuwendungen, der Bareinzahlungsbeleg, die Buchungsbestätigung, z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking, wenn die Zahlung zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten auf ein dafür eingerichtetes Konto einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt wird. Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren.
Spendenaktionen: Einer steuerbegünstigten Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert. Ruft z. B. eine steuerbegünstigte Körperschaft, die nach ihrer Satzung insbesondere mildtätige Zwecke verfolgt (z. B. ein Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein) zu Spenden zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten auf, kann sie die Spenden nicht zu Zwecken verwenden, die sie nach ihrer Satzung fördert.
Es gilt dann Folgendes: Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung, wenn sie Mittel, die sie in Sonderaktionen für die Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung unmittelbar selbst für den angegebenen Zweck verwendet. Auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit kann verzichtet werden. Es ist ferner unschädlich, wenn die Spenden beispielsweise entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten weitergeleitet werden. Die steuerbegünstigte Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden bescheinigen, die sie für Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten erhält und verwendet. Auf die Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen.
Es ist ausnahmsweise auch unschädlich, wenn sonstige vorhandene Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, ohne Änderung der Satzung zur unmittelbaren Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten einsetzt werden. Gleiches gilt für die Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten. Auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit kann verzichtet werden.
Vorübergehende Unterbringung von Kriegsflüchtlingen: Zweckbetriebe sind auch Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen. Finden auf Leistungen dieser Einrichtungen besondere steuerliche Vorschriften Anwendung (z. B. Umsatzsteuerbefreiung oder Umsatzsteuerermäßigung, werden sie auch auf die Leistungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine angewendet. Stellen steuerbegünstigte Körperschaften entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen zur Verfügung, die für die Bewältigung der Auswirkungen und Folgen des Krieges in der Ukraine notwendig sind, wird es nicht beanstandet, wenn diese Betätigungen sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb zugeordnet werden.
Vorübergehende Unterbringung: Die entgeltliche vorübergehende Unterbringung ist ohne Prüfung dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen. Bei der Unterbringung in Einrichtungen eines Betriebs gewerblicher Art richtet sich die steuerliche Behandlung grundsätzlich nach den allgemeinen steuerlichen Vorschriften. Die vorübergehende Nutzung zugunsten der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten führt aus Billigkeitsgründen nicht zu einer gewinnwirksamen Überführung ins Hoheitsvermögen und somit nicht zur Aufgabe des Betriebs gewerblicher Art. Für die Zeitspanne bis zur (Wieder-) Nutzung der Unterbringungsmöglichkeit zu ihrem ursprünglichen Zweck (z. B. als Sporthalle) ist das Einkommen des Betriebs gewerblicher Art aber insoweit mit Null anzusetzen.
Umsatzsteuer: Stellen steuerbegünstigte Körperschaften entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen zur Verfügung, die für die Bewältigung der Auswirkungen und Folgen des Krieges in der Ukraine notwendig sind, wird es nicht beanstandet, wenn diese Betätigungen sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb zugeordnet werden.
Quelle:BMF-Schreiben| Veröffentlichung| IV C 4 - S 2223/19/10003 :023| 23-10-2022